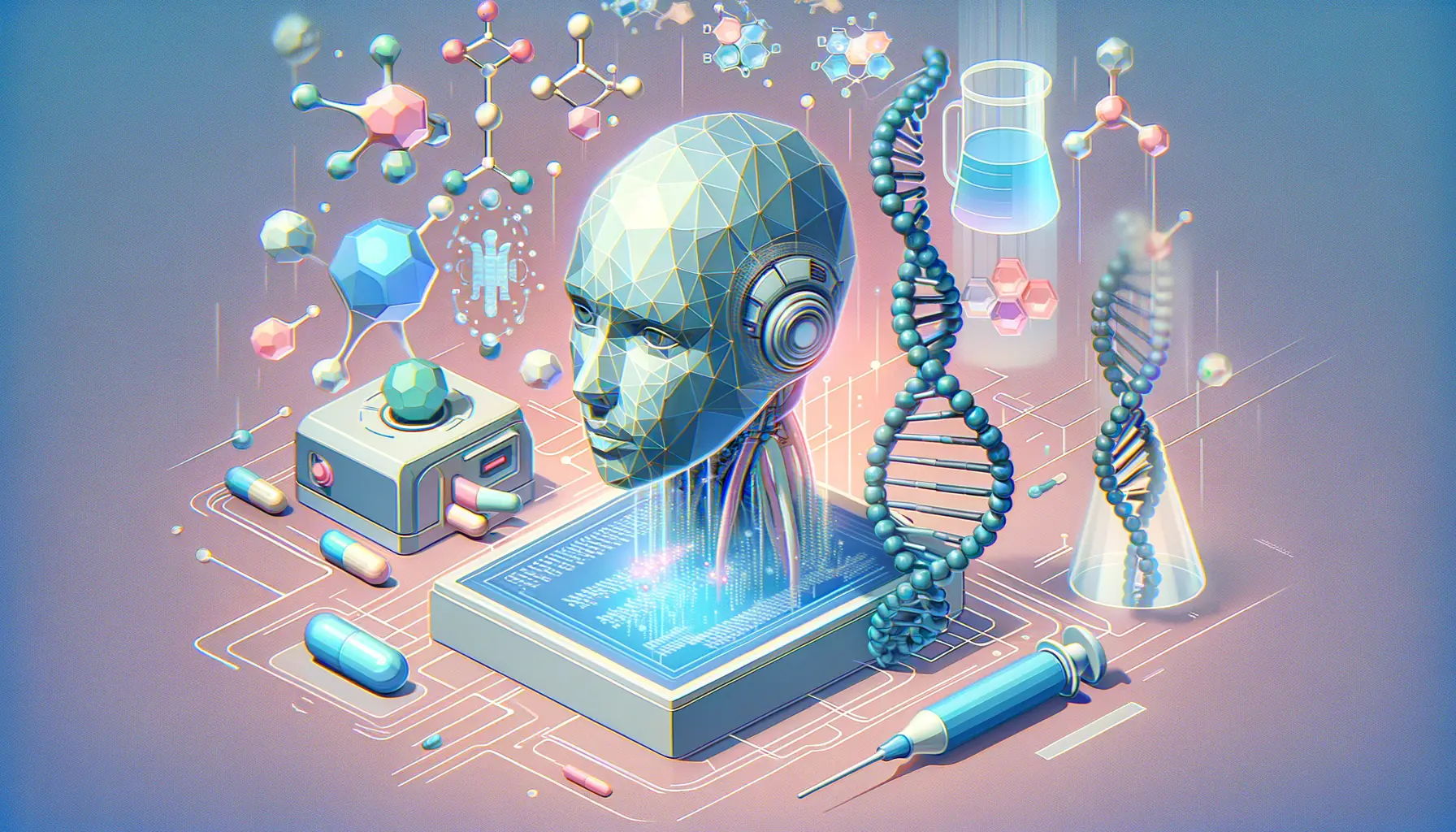4 Monaten her
China testet Unterwasser-Rechenzentrum bei Shanghai: Effizienz, Technik und Umweltfragen

Nahe Shanghai entsteht ein Unterwasser-Rechenzentrum, das als kommerzieller Pilot dienen soll. Das Projekt der Firma Highlander richtet sich an Kunden wie China Telecom und staatliche KI-Unternehmen und ist für Mitte Oktober angekündigt. Hintergrund ist der stark steigende Rechenbedarf durch KI sowie die Suche nach effizienteren Kühl- und Energiekonzepten.
Technisch setzt die Anlage auf natürliche Kühlung durch Meeresströmungen, wodurch laut Anbieter bis zu 90 Prozent der bisherigen Kühlenergie entfallen könnten. Mehr als 95 Prozent des Stroms sollen aus nahegelegenen Offshore-Windparks stammen. Eine Stahlkapsel mit Glasflocken-Beschichtung schützt vor Korrosion, ein Lift verbindet das Modul mit der Oberfläche für Wartung und Reparatur.
Microsoft hatte 2018 vor Schottland ein ähnliches Konzept erprobt; ein Marktangebot folgte bislang nicht. Fachleute wie Shaolei Ren ordnen aktuelle Projekte daher als Nachweis technischer Machbarkeit ein, während Fragen zu Wirtschaftlichkeit, Lebensdauer, Servicekosten und Ausfallmanagement noch zu klären sind.
Zu den operativen Risiken zählen die komplexere Netz-Anbindung unter Wasser und potenzielle neue Angriffsflächen. Forschungsteams aus Florida und Japan berichten von möglichen Stör- oder Angriffsvektoren über Schallwellen. Betreiber brauchen hierfür belastbare Sicherheits- und Monitoring-Konzepte, inklusive Notfallprozeduren.
Auch ökologische Effekte sollten eng begleitet werden. Wärmeeinträge können Arten anziehen oder verdrängen; laut dem Meeresökologen Andrew Wantt ist die Datenlage noch dünn. Highlander verweist auf unkritische Temperaturen in einem Test von 2020, doch bei breiterem Ausbau könnten kumulative Effekte auftreten. Ansätze wie die Nutzung von Abwärme für Aquakultur werden erforscht und könnten Auswirkungen mindern.
Technisch setzt die Anlage auf natürliche Kühlung durch Meeresströmungen, wodurch laut Anbieter bis zu 90 Prozent der bisherigen Kühlenergie entfallen könnten. Mehr als 95 Prozent des Stroms sollen aus nahegelegenen Offshore-Windparks stammen. Eine Stahlkapsel mit Glasflocken-Beschichtung schützt vor Korrosion, ein Lift verbindet das Modul mit der Oberfläche für Wartung und Reparatur.
Microsoft hatte 2018 vor Schottland ein ähnliches Konzept erprobt; ein Marktangebot folgte bislang nicht. Fachleute wie Shaolei Ren ordnen aktuelle Projekte daher als Nachweis technischer Machbarkeit ein, während Fragen zu Wirtschaftlichkeit, Lebensdauer, Servicekosten und Ausfallmanagement noch zu klären sind.
Zu den operativen Risiken zählen die komplexere Netz-Anbindung unter Wasser und potenzielle neue Angriffsflächen. Forschungsteams aus Florida und Japan berichten von möglichen Stör- oder Angriffsvektoren über Schallwellen. Betreiber brauchen hierfür belastbare Sicherheits- und Monitoring-Konzepte, inklusive Notfallprozeduren.
Auch ökologische Effekte sollten eng begleitet werden. Wärmeeinträge können Arten anziehen oder verdrängen; laut dem Meeresökologen Andrew Wantt ist die Datenlage noch dünn. Highlander verweist auf unkritische Temperaturen in einem Test von 2020, doch bei breiterem Ausbau könnten kumulative Effekte auftreten. Ansätze wie die Nutzung von Abwärme für Aquakultur werden erforscht und könnten Auswirkungen mindern.
Lesenswert hierzu
Dieser Artikel wurde vollständig oder teilweise durch eine Künstliche Intelligenz (KI) erstellt. Obwohl wir bemüht sind, genaue und aktuelle Informationen bereitzustellen, können wir keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts übernehmen. Bitte überprüfen Sie alle Informationen und ziehen Sie bei Bedarf eine fachkundige Beratung hinzu.